

Von den ersten Überlegungen bis hin zum laufenden Betrieb einer Energiegemeinschaft ist vieles zu entscheiden und in die Wege zu leiten. Neben der richtigen Zusammensetzung und passenden Organisationswahl ist der kooperative Austausch mit dem Netzbetreiber ein wesentliches Erfolgskriterium. Außerdem müssen einige Formalitäten beachtet und eingehalten werden.


Folgende grundlegende Fragen sollten vor der Gründung einer Energiegemeinschaft beantwortet werden:
Werfen Sie einen Blick auf unsere Tools – Sie helfen u.a. dabei, das optimale Verhältnis von Erzeugung und Verbrauch innerhalb einer EEG zu finden.

Sobald die ersten Fragen beantwortet sind, ist es empfehlenswert folgende Eckpunkte zu klären:
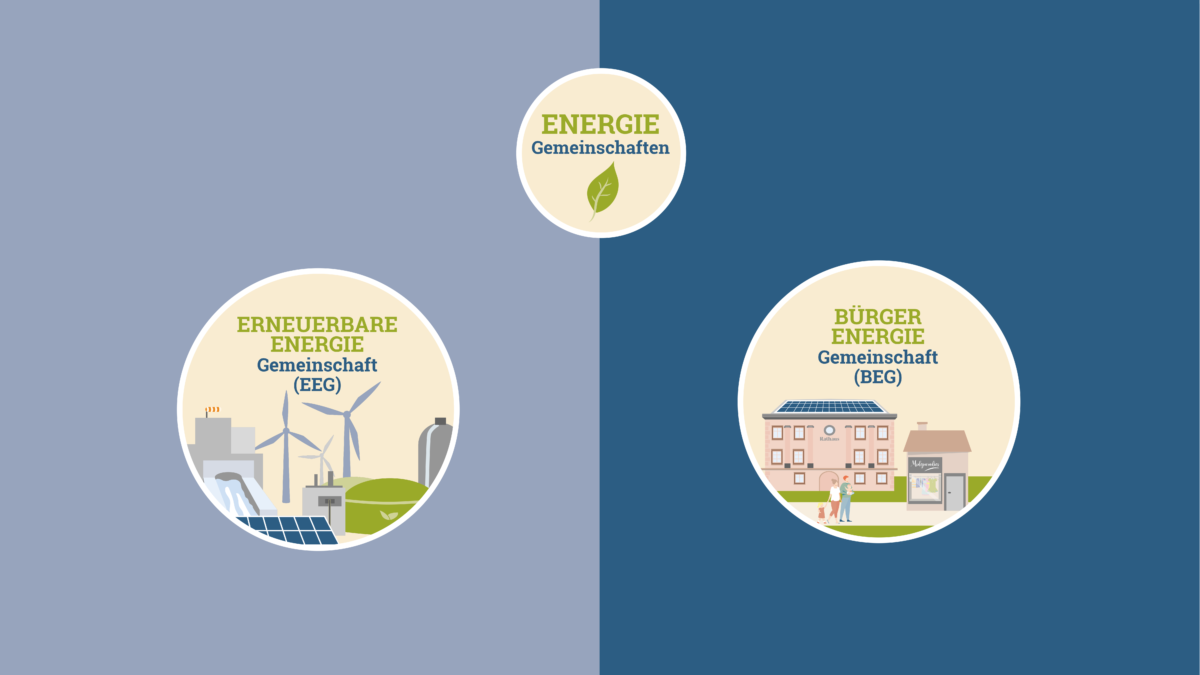
Je nach Aufbau und Anzahl der Teilnehmer:innen ist nun eine mehr oder weniger detaillierte und dokumentierte Projektplanung zu empfehlen. Die bereits gesammelten grundlegenden Informationen sollten in einem Konzept verarbeitet werden. Dabei sollte zuerst festgelegt werden, welche Art von Energiegemeinschaft gegründet und unter welcher Organisationsform die Gemeinschaft geführt werden soll (siehe dazu – Download am Ende der Seite). Auch Punkte wie die Gestaltung bzw. Abwicklung der internen Abrechnung und die Festlegung des Strompreises innerhalb der Energiegemeinschaft sollten beschlossen werden.

Betreiber:innen und Teilnehmer:innen gründen gemeinsam z. B. einen Verein oder eine Genossenschaft. Mit der Gründung der Gesellschaftsform wird die Gemeinschaft handlungsfähig. Zusätzlich sollten bei der Gründung auch innergemeinschaftliche Belange geregelt werden (Aufteilungsschlüssel, Abrechnung,…).
Außerdem ist eine Registrierung der Energiegemeinschaft als Marktteilnehmerin unter www.ebutilities.at notwendig. Ist die Registrierung abgeschlossen, erhält die Energiegemeinschaft eine Marktpartner-ID. Diese ID ist für die Anmeldung der Energiegemeinschaft beim Netzbetreiber notwendig.
Tipp: Diese Punkte sollten bei der Wahl der Organisationsform berücksichtigt werden:
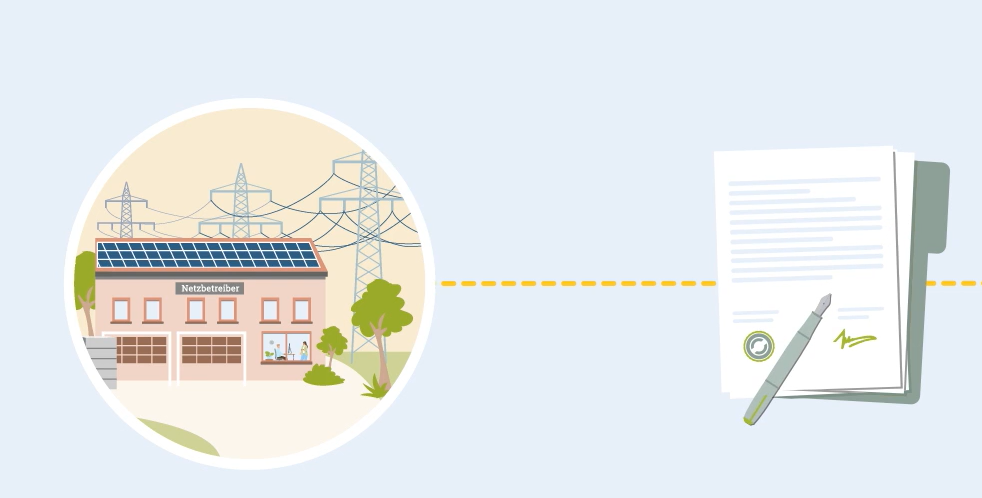
Mit dem Vertragsabschluss wird die Anmeldung der Energiegemeinschaft beim Netzbetreiber offiziell abgeschlossen.
Der Vertragsabschluss gliedert sich in zwei Bereiche:

Im letzten Schritt erfolgt die Anbindung an die Marktkommunikation (z. B. per EDA Anwenderportal). Durch die Anbindung kann die Energiegemeinschaften am Energiewirtschaftlichen Datenaustausch teilnehmen und zum Beispiel die An- und Abmeldung neuer Zählpunkte durchführen. Außerdem erhält sie die Informationen, wie viel Energie in der Gemeinschaft erzeugt und den einzelnen Verbraucher:innen zugewiesen wurde. Die Daten sind u. a. für die Abrechnung notwendig.
Je nach Größe und Komplexität einer Energiegemeinschaft kann für die Abrechnung eine zusätzliche externe Software hilfreich sein.
Der Netzbetreiber ist vom Gesetz her verpflichtet, die technischen Voraussetzungen (z. B. Smart Meter-Einbau, Sicherstellung einer stabilen Daten-Kommunikation) für die Energiegemeinschaft sicherzustellen.